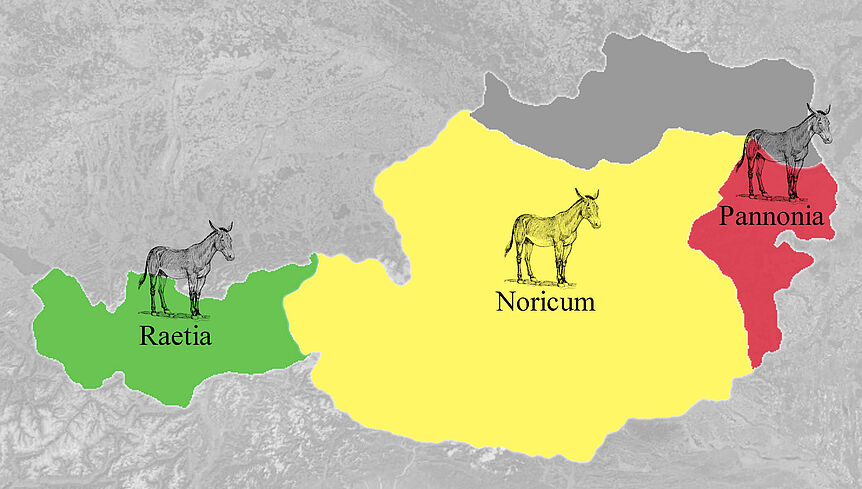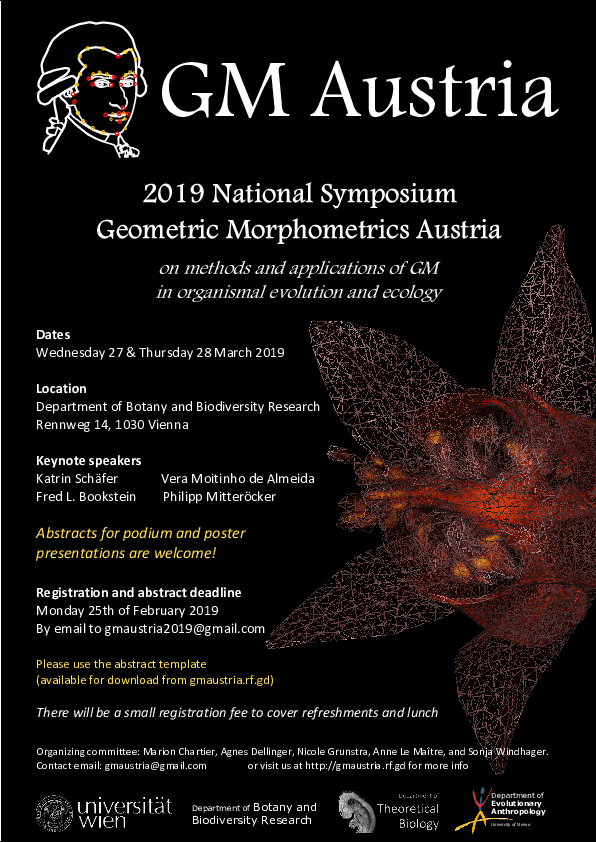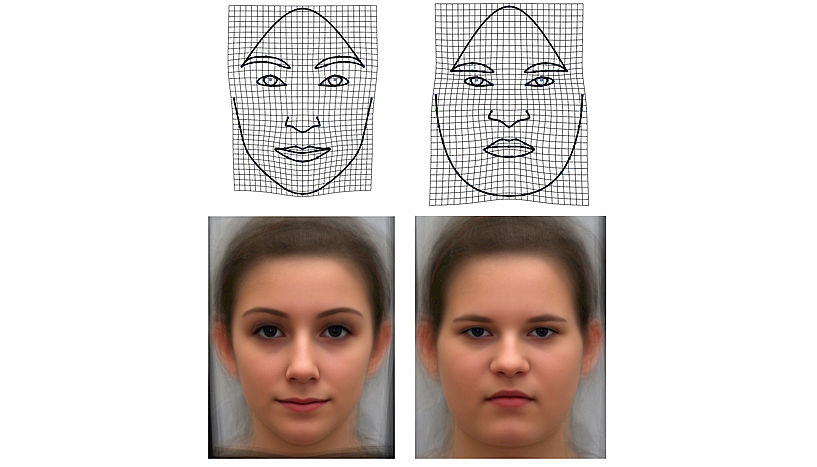News & Press releases
04.07.2024
16.01.2024
Muhammad Bilal Sharif has completed his PhD
20.10.2023
21.10.2022
VDSEE Completion Grant award
20.10.2022
01.01.2020
17.05.2018
04.05.2018
02.05.2018